Private Krankenversicherung – Vorteile, Nachteile und Kosten im Überblick
Die private Krankenversicherung (PKV) ist eine attraktive Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Sie bietet umfangreichere Leistungen, kürzere Wartezeiten bei Ärzten und Krankenhäusern und die Möglichkeit, den Versicherungsschutz individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Gleichzeitig ist die Entscheidung für eine PKV eine weitreichende Weichenstellung fürs Leben, die gut überlegt sein sollte. Denn neben den Vorteilen gibt es auch Nachteile, die nicht übersehen werden dürfen – insbesondere im Hinblick auf die Kosten im Alter und die fehlende kostenlose Familienversicherung.
In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über die Funktionsweise von PKV und GKV, die Unterschiede bei Leistungen, Beiträgen und Finanzierung, wer sich privat versichern kann, wie die Gesundheitsprüfung funktioniert und warum eine anonyme Risikovoranfrage sinnvoll ist. Wir zeigen Ihnen auch, wie sich die Beiträge entwickeln, wie Altersrückstellungen und Beitragsentlastungstarife wirken, und geben Ihnen wertvolle Tipps für die Beantragung und den langfristigen Schutz.
Das Wichtigste auf einen Blick
PKV mit individuellen Leistungen
Privatversicherte genießen besseren Schutz als gesetzlich Versicherte – etwa durch Chefarztbehandlung, Einbettzimmer und eine höhere Erstattung bei Zahnersatz.
Wer sich privat versichern kann
Privat versichern können sich Beamte, Selbständige, Freiberufler und Angestellte mit Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze.
Antragsprozess zur PKV
Vor Vertragsabschluss prüft die Versicherung den Gesundheitszustand. Eine anonyme Risikovoranfrage schützt vor Nachteilen bei Ablehnung.
Beitragsstabilität im Alter
Altersrückstellungen und Beitragsentlastungstarife helfen, die Beiträge langfristig bezahlbar zu halten.
Fragen

Wie funktioniert die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)?
Die gesetzliche Krankenversicherung ist das Rückgrat des deutschen Gesundheitssystems. Rund 88 % der Bevölkerung sind in der GKV versichert. Die Beiträge richten sich nach dem Einkommen, nicht nach Gesundheitszustand oder Alter. Familienangehörige ohne eigenes Einkommen (z. B. Kinder oder Ehepartner) sind kostenlos mitversichert.
Die Finanzierung der GKV erfolgt nach dem Solidarprinzip: Alle zahlen einkommensabhängige Beiträge, die Leistungen sind im Wesentlichen für alle gleich. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Beitrag bis zur Beitragsbemessungsgrenze (2025: 62.100 € Jahresbrutto). Abgerechnet wird nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM).
Leistungen sind auf das medizinisch Notwendige beschränkt. Höherwertige Versorgung, Chefarztbehandlung, Einbettzimmer oder umfassender Zahnersatz können über private Zusatzversicherungen abgesichert werden.
Wie funktioniert die private Krankenversicherung (PKV)?
Die PKV funktioniert nach einem anderen Prinzip als die GKV: Jeder Versicherte schließt einen individuellen Vertrag mit einem Versicherungsunternehmen ab. Die Beiträge richten sich nach dem Eintrittsalter, dem Gesundheitszustand und dem gewünschten Leistungsumfang. Statt über den EBM rechnen Ärzte und Zahnärzte nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bzw. Zahnärzte (GOZ) ab. PKV-Tarife erstatten häufig sogar Leistungen über den Höchstsätzen hinaus, was Privatversicherten Zugang zu modernsten Behandlungsmethoden verschafft.
Ein wesentlicher Unterschied: Es gibt keine kostenlose Familienversicherung. Ehepartner und Kinder müssen jeweils separat versichert werden. Dafür bietet die PKV umfangreiche Leistungen, die weit über das Niveau der GKV hinausgehen.
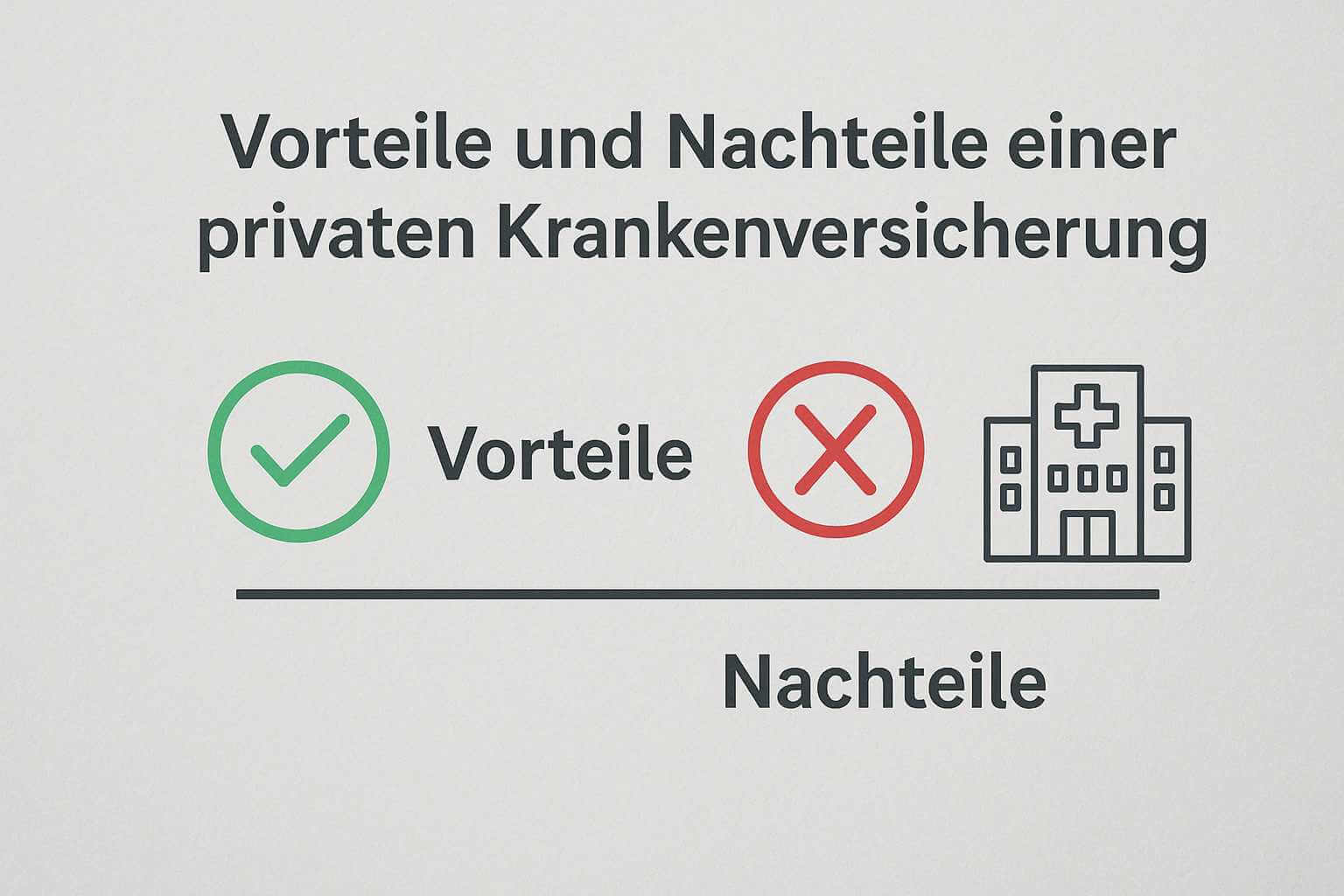
Welche Vorteile bietet die PKV im Vergleich zur GKV?
Die private Krankenversicherung überzeugt durch zahlreiche Vorteile, die besonders für Leistungsbewusste attraktiv sind. Während die GKV ihre Leistungen auf ein Grundniveau begrenzt, können Privatversicherte ihren Schutz individuell gestalten. Wer privat versichert ist, profitiert beispielsweise von kürzeren Wartezeiten beim Facharzt, bevorzugter Terminvergabe und Zugang zu Spezialisten. Im Krankenhaus bedeutet PKV-Schutz oft Behandlung durch den Chefarzt, Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer und eine bessere medizinische Ausstattung. Auch beim Zahnarzt sind hochwertige Materialien wie Keramikimplantate erstattungsfähig, während GKV-Versicherte hier schnell hohe Eigenanteile zahlen müssen.
Hinzu kommt die Möglichkeit der Beitragsrückerstattung: Wer in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch nimmt, erhält oft mehrere Monatsbeiträge zurück. Für viele Versicherte ist auch die Tatsache entscheidend, dass die PKV, Behandlungen über die GOÄ-Höchstsätze hinaus erstattet und dadurch modernste Therapieoptionen ermöglicht.
Welche Nachteile hat die private Krankenversicherung?
Neben den Vorteilen gibt es auch klare Nachteile, die bedacht werden müssen. Die private Krankenversicherung kennt keine beitragsfreie Familienversicherung. Für Ehepartner und Kinder müssen separate Beiträge gezahlt werden, was die Kosten für Familien spürbar erhöht. Ein weiterer Nachteil betrifft die Beitragsentwicklung im Alter. Auch wenn Altersrückstellungen gebildet werden, steigen die Prämien langfristig. Ohne einen Beitragsentlastungstarif kann die finanzielle Belastung im Ruhestand hoch sein. Zudem verlangt jede PKV eine Gesundheitsprüfung. Vorerkrankungen können zu Risikozuschlägen oder Leistungsausschlüssen führen. Ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung ist nach Vollendung des 55. Lebensjahres praktisch ausgeschlossen. Wer sich für die PKV entscheidet, sollte dies also als dauerhafte Lösung betrachten.
Wer kann sich privat versichern?
Nicht jeder kann frei wählen, ob er gesetzlich oder privat versichert ist. Die private Krankenversicherung ist in Deutschland an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Beamte und Beamtenanwärter sind eine der größten Gruppen, die sich privat versichern. Sie erhalten Beihilfe vom Dienstherrn, die zwischen 50 und 80 Prozent der Krankheitskosten abdeckt. Die Restkosten übernimmt die PKV.
Für Selbständige und Freiberufler ist die PKV ebenfalls möglich – unabhängig vom Einkommen. Angestellte können wechseln, sobald ihr Einkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) übersteigt. Diese liegt 2025 bei 69.300 € brutto im Jahr. Auch Studenten haben die Wahl, ob sie im Studententarif der GKV bleiben oder sich privat versichern.
Von der Bedarfsanalyse hin zur Beantragung der PKV
Der Weg in die private Krankenversicherung beginnt mit einer genauen Bedarfsanalyse. Zunächst wird geprüft, wie Sie derzeit abgesichert sind und welche Leistungen Ihnen wichtig sind – etwa Chefarztbehandlung, ein höheres Krankentagegeld oder spezielle Zahnleistungen. Anschließend werden die Gesundheitsfragen beantwortet. Hierbei ist es ratsam, Arztberichte und die Krankenakte einzuholen. Liegen Vorerkrankungen vor, kann eine anonyme Risikovoranfrage gestartet werden. Diese ermöglicht eine Einschätzung der Versicherer, ohne dass eine Ablehnung dauerhaft gespeichert wird.
Sind die gesundheitlichen Voraussetzungen geklärt, folgt der Tarifvergleich. Hierbei werden die Angebote der Versicherer den bisherigen Leistungen und Kosten gegenübergestellt. Erst danach erfolgt die Antragstellung beim passenden Anbieter.
Wieso für eine private Krankenversicherung Gesundheitsfragen beantwortet werden müssen
Anders als in der GKV entscheidet in der PKV der Versicherer selbst, ob und zu welchen Bedingungen er einen Antrag annimmt. Mit den Gesundheitsfragen prüft die Gesellschaft das individuelle Risiko, um stabile Beiträge für alle Mitglieder zu gewährleisten. Je nach Vorerkrankungen kann es zu Risikozuschlägen oder Ausschlüssen kommen. Wer hier falsche Angaben macht, riskiert im Leistungsfall den Verlust des Versicherungsschutzes. Deshalb ist es wichtig, die Gesundheitsfragen vollständig und korrekt zu beantworten. Eine anonyme Risikovoranfrage schützt zusätzlich vor Nachteilen, falls ein Antrag abgelehnt würde.
Was sind Altersrückstellungen und Beitragsentlastungstarife?
Ein zentrales Instrument der PKV sind die Altersrückstellungen. Sie sorgen dafür, dass Beiträge im Alter nicht unbezahlbar werden. Ab einem Alter von 21 Jahren werden diese Rücklagen gebildet, indem ein Teil des Monatsbeitrags in eine Art Sparreserve fließt. Die Mittel werden bis ins Rentenalter verzinst und helfen, künftige Beitragssteigerungen abzufedern. Neben den Altersrückstellungen gibt es Beitragsentlastungstarife. Dabei zahlt der Versicherte zusätzlich einen festgelegten Betrag in einen speziellen Tarif ein. Ab Renteneintritt reduziert sich dadurch der monatliche Beitrag. Beitragsentlastungstarife können flexibel gestaltet werden und gelten entweder nur für den Haupttarif oder für alle versicherten Leistungen. Wichtig ist: Bei einer späteren Anpassung können erneut Gesundheitsfragen notwendig sein.
Beitragsentwicklung der privaten und gesetzlichen Krankenkasse
Sowohl die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) als auch die private Krankenversicherung (PKV) haben in den letzten Jahrzehnten deutliche Beitragssteigerungen erfahren. 1990 lag der Beitragssatz in der GKV noch bei rund 12 % des Bruttoeinkommens. Im Jahr 2025 beträgt der allgemeine Beitragssatz 14,6 % zuzüglich eines kassenindividuellen Zusatzbeitrags von durchschnittlich 1,7 %. Damit ergibt sich ein Spitzensatz von rund 16,3 % des Bruttoeinkommens, der von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte getragen wird. Für Gutverdiener, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen (2025: 62.100 € Jahresbrutto), bedeutet dies einen monatlichen Maximalbeitrag von etwa 765 € – plus Zusatzbeitrag.
In der PKV werden die Beiträge nicht einkommensabhängig erhoben, sondern richten sich nach Eintrittsalter, Gesundheitszustand und Leistungsumfang. Ein junger Angestellter zahlt im Durchschnitt 350 bis 450 € monatlich, während Selbständige häufig zwischen 400 und 600 € liegen.
Beamte profitieren durch die Beihilfe ihres Dienstherrn und zahlen oft nur 150 bis 250 € im Monat. Im Alter steigen die Prämien an, können jedoch durch Altersrückstellungen und Beitragsentlastungstarife spürbar gedämpft werden.
Während die GKV ihre Finanzierung zunehmend über Zusatzbeiträge absichert, sorgt die PKV über kapitalgedeckte Systeme wie Altersrückstellungen dafür, dass Beiträge stabilisiert werden. Wer früh vorsorgt und zusätzliche Entlastungstarife einbaut, kann die Belastung im Ruhestand deutlich reduzieren.
Ein Blick auf die Entwicklung zeigt: Zwischen 1990 und 2025 stiegen die PKV-Beiträge im Durchschnitt um rund 3–4 % pro Jahr. In der GKV verlief die Entwicklung schwankender, da sie stark von politischen Entscheidungen und demografischen Faktoren beeinflusst wird. Damit ist die PKV zwar ebenfalls teurer geworden, bietet aber im Gegenzug einen deutlich höheren Leistungsumfang.
Private Krankenversicherung für Beamte und Beamtenanwärter
Beamte profitieren in besonderem Maße von der privaten Krankenversicherung, da ihr Dienstherr über die Beihilfe bereits zwischen 50 und 80 % der Krankheitskosten übernimmt. Die verbleibenden Kosten werden über eine private Restkostenversicherung abgesichert. Besonders sinnvoll ist die Kombination mit einem Beihilfeergänzungstarif, der Versorgungslücken schließt, zum Beispiel bei Zahnersatz oder Wahlleistungen im Krankenhaus.
Beamtenanwärter erhalten meist besonders günstige Einstiegstarife, die speziell auf ihre Situation zugeschnitten sind. Da ihr Einkommen zu Beginn oft noch geringer ist, profitieren sie von attraktiven Konditionen – gleichzeitig sichern sie sich den Vorteil, früh in die PKV einzutreten und so langfristig niedrigere Beiträge zu zahlen.
Private Krankenversicherung für Kinder und Ehepartner
Auch Kinder können in die private Krankenversicherung aufgenommen werden, wenn mindestens ein Elternteil privat versichert ist und dessen Einkommen oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Besonders vorteilhaft ist die sogenannte Kindernachversicherung: Innerhalb von zwei Monaten nach der Geburt können Neugeborene ohne erneute Gesundheitsprüfung in die PKV aufgenommen werden – mit denselben Leistungen wie ein Elternteil. Die Beiträge für Kinder liegen je nach Tarif und Leistungsumfang in der Regel zwischen 100 und 200 € monatlich. Für Ehepartner gilt: Sie müssen eigenständig versichert werden, wenn keine kostenlose Familienversicherung über die GKV möglich ist. Je nach Alter und Gesundheitszustand beginnen die Kosten hier meist bei 350 bis 400 € pro Monat.
Kann man die PKV wechseln oder kündigen?
Ein Wechsel der PKV ist möglich, sollte jedoch gut überlegt sein. Denn bei einem neuen Vertrag muss erneut eine Gesundheitsprüfung durchlaufen werden. Zudem gehen Altersrückstellungen beim Wechsel verloren oder werden nur teilweise übertragen. Auch die Beiträge können höher ausfallen, da das Eintrittsalter steigt. Eine Kündigung der PKV ist nur sinnvoll, wenn ein Wechsel in die GKV möglich ist – etwa bei Arbeitslosigkeit oder durch einen Wechsel in eine versicherungspflichtige Tätigkeit. In vielen Fällen ist ein interner Tarifwechsel innerhalb derselben Gesellschaft die bessere Lösung.
Wie werden Rechnungen bei der PKV eingereicht?
Privatversicherte erhalten nach einer Behandlung in der Regel eine Rechnung, die sie zunächst selbst bezahlen und anschließend bei der Versicherung einreichen. Bei ambulanten Rechnungen ist dies unkompliziert. Anders sieht es bei Krankenhausrechnungen aus, die schnell 5.000 € oder mehr betragen können. Viele PKV-Anbieter bieten deshalb eine Direktabrechnung mit der Klinik an. So muss der Versicherte die Summe nicht vorstrecken. Wichtig ist, sich im Vorfeld mit dem Versicherer abzustimmen.
Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte
Die Gebührenordnung (GOÄ und GOZ) legt die Honorare für ärztliche und zahnärztliche Leistungen fest. Während die GKV nur Behandlungen bis zum Regelsatz erstattet, können PKV-Tarife auch über den Höchstsätzen hinaus leisten. Das bedeutet: Privatversicherte haben Zugang zu Behandlungen, die gesetzlich Versicherten oft nicht oder nur eingeschränkt offenstehen.
Wie funktioniert die Beitragsrückerstattung in der PKV?
Die Beitragsrückerstattung belohnt Versicherte, die innerhalb eines Kalenderjahres keine Leistungen gegenüber ihrer PKV abgerechnet haben. Ziel ist ein fairer Ausgleich: Wer das System wenig in Anspruch nimmt, erhält einen Teil seiner Beiträge zurück. In der Praxis existieren zwei Modelle.
Die garantierte Beitragsrückerstattung (BRE), die vertraglich zugesagt ist und in fest definierten Höhen ausgezahlt wird (beispielsweise ein bis zwei Monatsbeiträge, abhängig vom Tarif und von der Anzahl leistungsfreier Jahre in Folge).
Zweitens die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (BRE), die von den wirtschaftlichen Ergebnissen des Versicherers abhängt und deshalb jährlich neu festgelegt wird. Häufig kombinieren Tarife beide Elemente, etwa eine kleine garantierte Rückerstattung plus eine zusätzliche, vom Unternehmenserfolg abhängige Auszahlung.
Voraussetzung für die BRE ist in aller Regel, dass Sie im betreffenden Kalenderjahr keine erstattungsfähigen Leistungen eingereicht haben. Rechnungen, die vollständig unter Ihrer Selbstbeteiligung liegen und die Sie bewusst nicht einreichen, gelten in vielen Tarifen trotzdem als „leistungsfrei“. Dadurch lassen sich Selbstbeteiligung und Beitragsrückerstattung strategisch kombinieren.
Ein Beispiel: Ihr Beitrag beträgt 420 € monatlich, die garantierte BRE liegt bei zwei Monatsbeiträgen (840 €), und Ihre jährlichen Arztkosten summieren sich auf 300 €. Reichen Sie diese 300 € nicht ein, erhalten Sie die BRE von 840 € – per Saldo ist das günstiger, als die 300 € zu erstatten und dadurch die Rückerstattung zu verlieren.
Wichtig sind hier zwei Dinge: Erstens müssen Sie die Tarifbedingungen kennen (manche Tarife verlangen absolute Leistungsfreiheit, andere akzeptieren zurückgehaltene Kleinrechnungen). Zweitens sollten Sie medizinisch Sinnvolles nie aus BRE-Gründen aufschieben. Gesundheit geht vor Optimierung.
Die Höhe der BRE variiert je nach Tarif. Üblich sind Spannen von einem bis zu mehreren Monatsbeiträgen, mit Staffelungen für mehrere leistungsfreie Jahre in Folge. In Familientarifen wird die Beitragsrückerstattung in der Regel für jede versicherte Person separat betrachtet, sodass eine eingereichte Rechnung eines Angehörigen die Beitragsrückerstattung der anderen nicht automatisch entfallen lässt – maßgeblich sind aber die konkreten Bedingungen Ihres Anbieters. Zu beachten ist außerdem die steuerliche Wirkung: Rückerstattete Beiträge mindern im Jahr der Auszahlung grundsätzlich die als Vorsorgeaufwendungen absetzbaren PKV-Beiträge.
Beitragsaufteilung der PKV im Berufsleben und in der Rente
Während des Berufslebens beteiligen sich Arbeitgeber an den Kosten der privaten Krankenversicherung. Grundsätzlich übernehmen sie 50 % des Beitrags, allerdings nur bis zu einer gesetzlich festgelegten Höchstgrenze. Diese orientiert sich am Beitrag, den der Arbeitgeber maximal für einen gesetzlich versicherten Arbeitnehmer zahlen müsste. Im Jahr 2025 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung 5.175 € monatlich. Multipliziert mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % und dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 1,7 % ergibt sich ein fiktiver Höchstbeitrag von 843,53 € pro Monat in der GKV. Daraus ergibt sich der maximale Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung von 421,77 € pro Monat. Zusätzlich beteiligt sich der Arbeitgeber auch an der privaten Pflegepflichtversicherung – ebenfalls bis maximal zur Hälfte des Höchstbeitrags in der sozialen Pflegeversicherung. Das bedeutet für 2025 einen zusätzlichen Zuschuss von rund 92 € monatlich. Insgesamt kann der Arbeitgeber also bis zu 514 € pro Monat zu den Kosten der PKV beisteuern.
In der Rente entfällt dieser Zuschuss durch den Arbeitgeber. Stattdessen zahlt die gesetzliche Rentenversicherung einen Beitragszuschuss, der dem Arbeitgeberanteil in der GKV entspricht. Die Höhe liegt jedoch meist deutlich unter dem, was ein Arbeitgeber während des Berufslebens übernimmt. Viele Rentner müssen ihre PKV-Beiträge daher weitgehend allein tragen. Um die Belastung im Alter abzufedern, bietet sich frühzeitig der Einschluss eines Beitragsentlastungstarif an.
Wie funktioniert die Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung?
Eine Selbstbeteiligung (SB) bedeutet, dass Sie einen Teil Ihrer jährlichen Behandlungskosten aus eigener Tasche zahlen und im Gegenzug einen spürbar niedrigeren Beitrag erhalten. In vielen Tarifen wird die SB als fester Jahresbetrag vereinbart, zum Beispiel 300 €, 600 €, 1.200 € oder 2.400 € pro Kalenderjahr. Manche Tarife differenzieren zusätzlich nach Leistungsbereichen (etwa eine ambulante SB, während stationäre Leistungen ohne SB erstattet werden) oder sehen eine prozentuale Beteiligung bis zu einem Höchstbetrag vor. Wichtig ist: Die SB gilt in aller Regel pro Kalenderjahr und pro versicherte Person. Zuzahlungen wie in der GKV gibt es nicht – maßgeblich sind die tariflichen Erstattungsregeln der PKV. Ob sich eine Selbstbeteiligung lohnt, hängt von zwei Faktoren ab: von Ihrer realistischen Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und von der tatsächlichen Beitragseinsparung im gewählten Tarif.
Ein einfaches Rechenbeispiel hilft bei der Einordnung: Kostet der Tarif ohne SB 450 € im Monat und mit 600 € SB nur 400 €, sparen Sie 50 € monatlich bzw. 600 € im Jahr. Bleiben Ihre erstattungsfähigen Rechnungen unter 600 €, fahren Sie mit SB besser. Überschreiten die Rechnungen diesen Betrag deutlich, kann der Vorteil schrumpfen.
In der Praxis gilt deshalb: Wählen Sie die Höhe der SB so, dass die voraussichtliche jährliche Ersparnis den typischen Behandlungsaufwand realistisch übersteigt – und planen Sie Reserven für unvorhergesehene Ereignisse ein. Für Familien sollte die Liquidität besonders im Blick behalten werden, da jede Person ihre eigene Selbstbeteiligung hat und mehrere kleinere Behandlungen zusammen schnell die jährliche Eigenbelastung erhöhen können.
Ein häufiger Irrtum ist, dass die Selbstbeteiligung „verfällt“, wenn Sie Rechnungen nicht einreichen. Richtig ist: Kosten unterhalb der SB sind ohnehin von Ihnen zu tragen. Reichen Sie sie nicht ein, gelten Sie für den Versicherer in vielen Tarifen dennoch als „leistungsfrei“ – was später für eine Beitragsrückerstattung (siehe vorherigen Abschnitt) relevant sein kann. Allerdings sollten Sie immer die Bedingungen beachten. Manche Gesellschaften verlangen für die Beitragsrückerstattung absolute Leistungsfreiheit, andere akzeptieren, dass nicht erstattungsfähige Kleinrechnungen bewusst zurückgehalten werden. Zudem gibt es Einreichungsfristen. Viele Versicherer erstatten Rechnungen auch noch rückwirkend – häufig bis zu drei Kalenderjahre, gerechnet ab Jahresende –, die genauen Fristen ergeben sich aber aus den jeweiligen Tarif- und Versicherungsbedingungen. Aus steuerlicher Sicht kann eine sehr hohe Selbstbeteiligung nachteilig sein, wenn dadurch medizinische Ausgaben privat hängenbleiben, die steuerlich nicht oder nur über hohe zumutbare Eigenanteile berücksichtigungsfähig sind. Auch für die Zukunft sollten Sie Flexibilität einplanen. Eine spätere Senkung der Selbstbeteiligung ist möglich, kann aber je nach Tarif und Zeitpunkt eine erneute Risikoprüfung auslösen oder nur zum Jahreshauptfälligkeitstermin erlaubt sein. Umgekehrt ist die Erhöhung der SB oft einfacher, führt allerdings zu dauerhaft geringeren Erstattungen.
Kann man Beiträge zur privaten Krankenversicherung von der Steuer absetzen?
Die Beiträge zur privaten Krankenversicherung können als Vorsorgeaufwendungen steuerlich geltend gemacht werden. Absetzbar sind insbesondere die Kosten für die Basisabsicherung, also Leistungen, die denen der GKV entsprechen. Zusatzleistungen wie Einbettzimmer oder Chefarztbehandlung sind steuerlich nicht absetzbar.
Was passiert mit der PKV bei sinkendem Einkommen?
Grundsätzlich ist die PKV an die Jahresarbeitsentgeltgrenze gebunden. Fällt das Einkommen dauerhaft unter diese Grenze, besteht Versicherungspflicht in der GKV. Wer jedoch bereits privat versichert ist, kann über eine Anwartschaft den bestehenden Vertrag ruhen lassen und später wieder aktivieren. So gehen keine Altersrückstellungen verloren.
Auf was sollte man beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung achten?
Beim Abschluss einer PKV ist es entscheidend, die Gesundheitsfragen korrekt zu beantworten. Hilfreich sind hier Patienten- oder Krankenakten, die die letzten fünf bis zehn Jahre dokumentieren. Außerdem sollten Sie auf eine solide Tarifauswahl mit guten Leistungen achten – auch wenn ein günstiger Beitrag kurzfristig verlockend erscheint. Ein Wechsel sollte niemals nur wegen eines niedrigeren Beitrags erfolgen, sondern wegen eines besseren Leistungsumfangs. Denn die PKV ist eine langfristige Entscheidung, die Ihr gesamtes Leben betrifft.

Ihr Ansprechpartner rund um die private Krankenversicherung
Die Entscheidung für eine private Krankenversicherung ist komplex und sollte nicht ohne fachliche Unterstützung getroffen werden. Als Finanzprofis Allgäu begleiten wir Sie unabhängig und objektiv bei allen Fragen zur PKV. Wir prüfen für Sie Angebote von Allianz, LKH, SDK, Barmenia, Continentale, DKV oder der Bayerischen Beamtenkrankenkasse, vergleichen Leistungen und Kosten und unterstützen Sie bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen. An unseren Standorten in Kempten und Sonthofen beraten wir Sie persönlich – oder deutschlandweit digital. Unser Ziel ist es, Ihnen langfristig den passenden Versicherungsschutz zu bieten.
Zusammenfassung
Die private Krankenversicherung bietet deutlich mehr Leistungen als die gesetzliche Krankenversicherung – von Chefarztbehandlung über Einbettzimmer bis hin zu hochwertigem Zahnersatz. Gleichzeitig erfordert sie eine Gesundheitsprüfung, ist für Familien teurer und bringt höhere Beiträge im Alter mit sich. Wer sich privat versichern möchte, sollte daher eine sorgfältige Bedarfsanalyse durchführen, eine anonyme Risikovoranfrage stellen falls notwendig und die Angebote verschiedener Anbieter vergleichen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Gehaltsgrenze gilt für die PKV?
2025 liegt die Jahresarbeitsentgeltgrenze bei 69.300 € brutto. Angestellte über dieser Grenze können sich privat versichern.
Wer zahlt die Beiträge zur PKV in der Rente?
Rentner tragen die Beiträge selbst. Die Rentenversicherung zahlt einen Zuschuss in Höhe des Arbeitgeberanteils.
Was kostet die gesetzliche Krankenversicherung für Rentner?
Rentner in der GKV zahlen rund 15–16 % ihres Einkommens als Beitrag.
Welche Vorteile hat die PKV gegenüber der GKV?
Bessere Leistungen, kürzere Wartezeiten, freie Arztwahl und höhere Erstattungssätze.
Welche Nachteile hat die private Krankenversicherung?
Keine Familienversicherung, Gesundheitsprüfung, steigende Beiträge im Alter und erschwerter Rückweg in die GKV.
Kann man die PKV kündigen?
Ja, allerdings nur mit Nachweis einer neuen Krankenversicherung. Ein Wechsel in die GKV ist nur in Ausnahmefällen möglich.
Wie hoch sind die Kosten für Kinder in der PKV?
Je nach Tarif zwischen 100 und 200 € monatlich. Neugeborene können ohne Gesundheitsprüfung nachversichert werden.
Kann ich PKV-Beiträge von der Steuer absetzen?
Ja, die Basisabsicherung ist steuerlich absetzbar. Zusatzleistungen hingegen nicht.
Kann ich trotz geringem Einkommen privat versichert bleiben?
Ja, solange Sie bereits PKV-versichert sind. Fällt Ihr Einkommen jedoch dauerhaft unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze, entsteht Versicherungspflicht in der GKV. Mit einer Anwartschaftsversicherung können Sie den PKV-Vertrag ruhen lassen und später ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder aktivieren.
Was sind Altersrückstellungen in der PKV?
Altersrückstellungen sind finanzielle Rücklagen, die ab dem 21. Lebensjahr gebildet werden. Ein Teil des Monatsbeitrags fließt in diese Reserve, um Beitragssteigerungen im Alter auszugleichen. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die PKV auch im Ruhestand bezahlbar bleibt.
